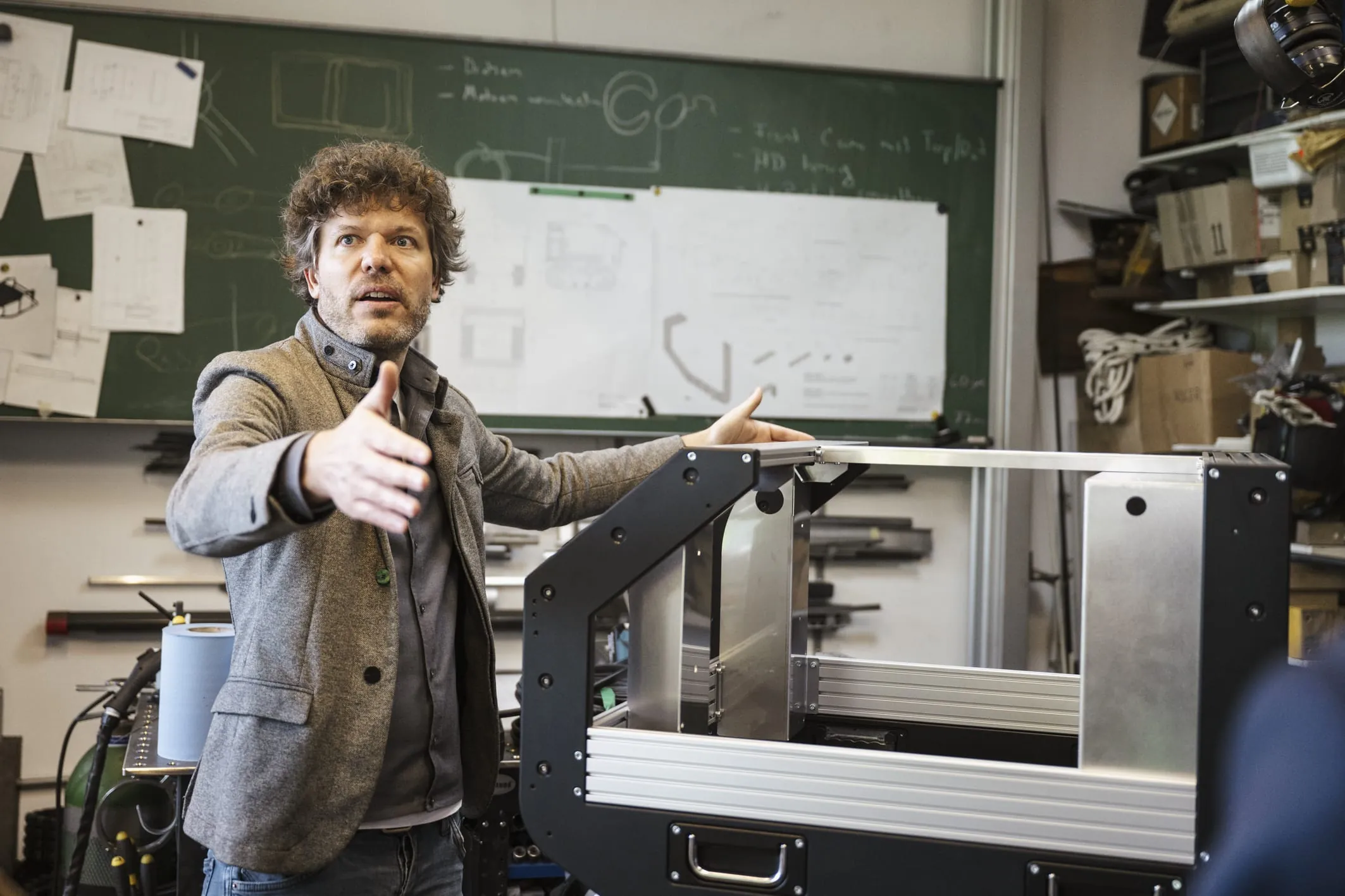Ein KI-gesteuerter Roboter namens "Feldfreund" soll das Landwirte-Leben leichter machen. Aber wie führt man so ein innovatives Produkt zum Erfolg? Ein Treffen mit dem Seifriz-Siegerduo.

Während in Havixbeck bei Münster ein Hahn kräht, formuliert Rodja Trappe, CEO der Zauberzeug GmbH, seine Zukunftsvision: Schwärme von KI-gesteuerten Feldrobotern sollen in ein paar Jahren auf den riesigen Zuckerrübenfeldern der Uckermark Unkraut jäten. Ein körperlich anstrengender und schweißtreibender Job, den heute kaum noch einer machen möchte – gerade in Arbeits- und Fachkräftemangel-Zeiten wie diesen. Doch warum lamentieren, wenn es die Lösung bereits gibt. Sie steht neben Trappe in der Wiese, wiegt rund 100 Kilogramm und hört auf den einprägsamen Namen Feldfreund.
Zauberzeug, ein Ideen-Inkubator im Bereich Robotik und intelligenter Software plus Expertise in Feinwerkmechanik, hat gemeinsam mit Wissenschaftlern von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNEE) Trappes Vision in eine Innovation gegossen – und damit in diesem Jahr einen Seifriz-Preis abgeräumt. „Das ist eine große Ehre für uns“, betont Prof. Dr. Ralf Bloch, Sparringspartner von Trappe und somit der andere Teil des Seifriz-Siegerduos, während der Preisverleihung im Handwerksbetrieb.
Der "Feldfreund" hat viele Einsatzgebiete
Doch der kleine Feldfreund sieht nicht nur knuffig aus, er hat auch einen klaren Auftrag. „Bei ihm handelt es sich um einen hochmodularen, KI-gestützten Agrarroboter mit bodenschonendem Raupenlaufwerk“, erklärt Trappe. „Landwirte können in seinem geschützten Innenraum Präzisionswerkzeuge zum Jäten, Säen, Inspizieren, Analysieren oder Ernten einsetzen.“
Zwar wäre der CEO in der Lage, den KI-Feldroboter via Smartphone mir nichts, dir nichts rund um den Handwerksbetrieb zu scheuchen, doch der Feldfreund arbeitet lieber vollkommen autark. „Durch die von uns selbst entwickelte Software ‚Learning Loop‘, die stets enthalten ist, kann die Maschine Kulturpflanzen und Beikräuter präzise voneinander unterscheiden“, berichtet der Handwerkschef stolz.
Aktuell ein "Feldfreund" pro Monat
Für diese Präzision war das Feedback der Landwirte wichtig. „Das Produkt kann man nicht vorher auf dem Papier durchplanen“, berichtet Wissenschaftler Bloch. Und Trappe ergänzt: „Die Landwirte wollten beispielsweise gerne etwas dranschrauben.“ Ein Impuls, den das Team gleich aufgriff. Kein Wunder, dass es mittlerweile Zubehör wie die Unkraut-Schraube, den Tornado fürs Entfernen kleiner Pflanzen oder die Pendelhacke als Ergänzung zur Unkraut-Schraube gibt. Aktuell stellt Zauberzeug in Manufakturarbeit einen Feldroboter pro Monat her. Das mittelfristige Ziel: zehnmal so viele. Trappes Augen funkeln: „Die Skalierung ist enorm!“
Locker und professionell
Fünfeinhalb Auto-Stunden liegen zwischen dem Unternehmen aus dem Kammerbezirk Münster, das aktuell 19 Mitarbeiter beschäftigt, und der HNEE. Eine große Distanz, die man beim Umgang untereinander nicht merkt. Hier die Handwerker, dort die Wissenschaftler? Mitnichten. „Das Projekt hat mit jedem Tag mehr Spaß gemacht. Niemand hat es als Arbeit empfunden“, erinnert sich Trappe an den intensiven Austausch, der pandemiebedingt viel über Videocalls stattfand. „Jeder hatte eine super Rolle inne“, pflichtet Professor Bloch, Experte für Agrarökologie und nachhaltige Anbausysteme, dem Handwerkschef bei.
Ein Garant für den Erfolg dürfte auch die gute Arbeitsteilung gewesen sein. „Bei uns lag die technische Umsetzung des Projekts samt Konstruktion und Programmierung des Feldroboters“, so Trappe. Mit Arbeitsschritten wie dem Aufbau der optischen Sensorik, der Entwicklung der Unkraut-Hackmechanik oder der Erstellung der KI-Logik für die Frucht- und Unkrauterkennung. Die HNEE hingegen kümmerte sich etwa darum, welche Rahmenbedingungen und Anforderungen die regionalen Landwirte an „Zuckerrüben-Anbauverfahren und Unkrautregulierung“ haben. Auch die fortlaufende Betreuung von sogenannten On-Farm-Versuchen auf der HNEE-Lehr- und Forschungsstation Gut Wilmersdorf standen im Projektplan. Von regelmäßigen wissenschaftlichen Reflexionen ganz zu schweigen.
Was Handwerksbetriebe vom "Feldfreund" lernen können
Doch wie können andere Betriebe vom Know-how, das die beiden Seifriz-Preisträger und ihre Teams in den Feldfreund gesteckt haben, lernen?
Das Siegerduo hat vier Punkte parat:
- Kein Wettstreit: Jeder teilt seine Erfahrungen – wie der Open-Source-Ansatz bei Steuerung und Programmierung zeigt.
- Groß denken: Der Roboter war immer als Massenprodukt geplant – zum Preis von 25.000 Euro.
- Unabhängigkeit: Der Roboter wurde für den Agrarsektor konzipiert. Aber auch andere Branchen sind denkbar.
- Richtige Richtung: Der E-Antrieb greift den Nachhaltigkeitstrend auf.
Zurück zu Trappes Vision mit dem Roboterschwarm. „Wir helfen Landwirten, die Herausforderungen einer ökologisch orientierten Landwirtschaft zu bewältigen und ihre ökonomischen Ziele zu erreichen“, sagt der CEO. Die Zusammenarbeit zeige, so Bloch, wie man gemeinsam die landwirtschaftlichen Betriebe effizient stärken könne. Große Aufgaben also für den kleinen Feldfreund und dessen Freunde und Freundesfreunde.
Hintergrund: Das ist der „Seifriz“
Der renommierte „Seifriz – Transferpreis Handwerk + Wissenschaft“ wird unter der Federführung von Handwerk BW durch den Verein Technologietransfer Handwerk e.V. und in Zusammenarbeit mit handwerk magazin veranstaltet. Partner des Preises sind Holzmann Medien und die Signal Iduna Gruppe für Versicherungen und Finanzen, die die Hauptpreise stiften. Der neue „Sonderpreis für ganzheitliche Nachhaltigkeit“ wird von der IKK classic dotiert. Die Preisgelder: insgesamt bis zu 25.000 Euro – plus Teilnahme am Kongress „Zukunft Handwerk“, der vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München stattfand.